Frühe Zeiten - Arbeit vor der FR
Vergiß Kränkungen, aber nie Freundlichkeiten.
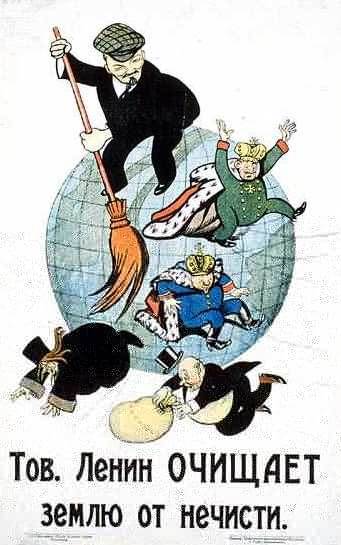 Das "Hamburger Echo" überlebte den Weggang Karl Grobes gerade mal ein Jahr. Der "Vorwärts", zu dem er wechselte, trägt zumindest noch diesen Titel. 1968 kam die historisch bedeutsame Stunde der "Frankfurter Rundschau". Grobes Artikel passten in Zeiten von Notstandsgesetzgebung und Großer Koalition den SPD-Parteioberen nicht mehr ins Konzept. Karl beschloss, den "Vorwärts" zu verlassen und erwog einen Wechsel zum "Weser-Kurier" nach Bremen.
Das "Hamburger Echo" überlebte den Weggang Karl Grobes gerade mal ein Jahr. Der "Vorwärts", zu dem er wechselte, trägt zumindest noch diesen Titel. 1968 kam die historisch bedeutsame Stunde der "Frankfurter Rundschau". Grobes Artikel passten in Zeiten von Notstandsgesetzgebung und Großer Koalition den SPD-Parteioberen nicht mehr ins Konzept. Karl beschloss, den "Vorwärts" zu verlassen und erwog einen Wechsel zum "Weser-Kurier" nach Bremen.
Doch dessen Verleger hatte weder Stelle noch genügend Geld - so dass er seinen alten Freund Karl Gerold ins Spiel brachte. Der FR-Herausgeber war gerade zur Kur, so dass die Einladung nach Frankfurt von Karl-Hermann Flach ausging: "Kommen Sie doch mal vorbei, falls Sie mal zufällig in Frankfurt sind." Drei Tage später weilte Karl Grobe "zufällig" in Frankfurt bei seinen Schwiegereltern - die gemeinsame publizistische Erfolgsgeschichte konnte beginnen.
Frühwerk: Texte aus dem "Hamburger Echo"
Herzlichen Dank dem
Rechercheteam der
Bibilothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn.
Ein Blick zurück - nicht ohne das liebste Werkzeug
Es war im Jahre 9 v.d.I. (vor dem Internet). Genauer gesagt, am 12.
Oktober 1964 vormittags. Die Agenturen meldeten, die Sowjets hätten ein Raumschiff
mit sage und schreibe drei Personen an Bord in die Umlaufbahn befördert.
Das war ein Thema für die Abendzeitung, für die ich damals zu schreiben die
Ehre hatte (es war eine Ehre; von Gehalt konnte man bei einer sozialdemokratischen
Lokalzeitung kaum reden, ohne so rot zu werden, wie das Blatt gar nicht mehr
war). Die Redaktion hätte den Lesern - es gab sie wirklich im Plural - mitgeteilt,
wer an Bord war und weshalb. Das sagten die Agenturen nicht weiter.
 Der Moskauer Rundfunk aber würde den Weltraum-Triumph mit Fanfaren feiern,
sagte ich mir. Ein Rundfunkgerät mit ganz brauchbarem Kurzwellenteil hatten
wir. Draht hatten wir auch, um eine Antenne zu improvisieren, und Moskau
war gut zu hören, in russischer Sprache; die Frage, ob ich das denn verstehen
könne, gar noch Kommunist sei (wer sonst gab sich mit Stalins Sprache ab?),
überhörte ich in professionellem Eifer und konnte den Lesern die Namen Komarow,
Feoktistow und Jegorow mitteilen, 24 Stunden vor der Konkurrenz. Auf diese
Weise wurde das technische Gerät aus der Sparte Unterhaltungselektronik zum
Werkzeug der Nachrichtenbeschaffung.
Der Moskauer Rundfunk aber würde den Weltraum-Triumph mit Fanfaren feiern,
sagte ich mir. Ein Rundfunkgerät mit ganz brauchbarem Kurzwellenteil hatten
wir. Draht hatten wir auch, um eine Antenne zu improvisieren, und Moskau
war gut zu hören, in russischer Sprache; die Frage, ob ich das denn verstehen
könne, gar noch Kommunist sei (wer sonst gab sich mit Stalins Sprache ab?),
überhörte ich in professionellem Eifer und konnte den Lesern die Namen Komarow,
Feoktistow und Jegorow mitteilen, 24 Stunden vor der Konkurrenz. Auf diese
Weise wurde das technische Gerät aus der Sparte Unterhaltungselektronik zum
Werkzeug der Nachrichtenbeschaffung.
Es war nicht das abgebildete Gerät; was wir damals benutzten war ein umfangreicher
Röhrenempfänger. Die Transistoren waren gerade erst erfunden, von integrierten
Schaltkreisen wusste kaum der Fachmann im Reparaturladen, und Chips - noch
ohne den Zusatz "Mikro" - kannten wir als englische Beigabe zum Nationalgericht
fish. Das Radio oben im Bild steht in meinem Büro. Leider passt es nicht
ganz problemlos ins Reisegepäck.
Die Japaner haben nun längst alles viel kleiner gemacht, die Taiwaner und
die übrigen Chinesen haben die Miniaturisierung bis in den Bereich der Preisgestaltung
fortgesetzt, so dass ich bei Touren in fremde Länder einen Weltempfänger
mitnehmen kann, der nicht wesentlich größer ist als mein Brillenfutteral
und trotzdem als Instrument der Nachrichtenversorgung viel mehr leistet als
die Holz- und Metallkiste von anno 1964.
Die Deutsche Welle spürt die mit Elektronik vollgestopfte Plastik-Schachtel
in Hiroshima oder in Pretoria ebenso zuverlässig auf wie die immer noch unübertrefflich
akkurate British Broadcasting Corporation. Gelegentlich konnte ich - mit
bescheidener Geste angebend - Bonner Amtsträgern draußen in der fernen Welt
erzählen, wie hoch ihre Partei gerade eben Kommunalwahlen gewonnen hat. Doch
das Werkzeug Weltempfänger ist geradezu unentbehrlich in Staaten, in denen
Nachrichten zensiert werden. Kurzwelle kommt immer durch.
 Der Moskauer Rundfunk aber würde den Weltraum-Triumph mit Fanfaren feiern,
sagte ich mir. Ein Rundfunkgerät mit ganz brauchbarem Kurzwellenteil hatten
wir. Draht hatten wir auch, um eine Antenne zu improvisieren, und Moskau
war gut zu hören, in russischer Sprache; die Frage, ob ich das denn verstehen
könne, gar noch Kommunist sei (wer sonst gab sich mit Stalins Sprache ab?),
überhörte ich in professionellem Eifer und konnte den Lesern die Namen Komarow,
Feoktistow und Jegorow mitteilen, 24 Stunden vor der Konkurrenz. Auf diese
Weise wurde das technische Gerät aus der Sparte Unterhaltungselektronik zum
Werkzeug der Nachrichtenbeschaffung.
Der Moskauer Rundfunk aber würde den Weltraum-Triumph mit Fanfaren feiern,
sagte ich mir. Ein Rundfunkgerät mit ganz brauchbarem Kurzwellenteil hatten
wir. Draht hatten wir auch, um eine Antenne zu improvisieren, und Moskau
war gut zu hören, in russischer Sprache; die Frage, ob ich das denn verstehen
könne, gar noch Kommunist sei (wer sonst gab sich mit Stalins Sprache ab?),
überhörte ich in professionellem Eifer und konnte den Lesern die Namen Komarow,
Feoktistow und Jegorow mitteilen, 24 Stunden vor der Konkurrenz. Auf diese
Weise wurde das technische Gerät aus der Sparte Unterhaltungselektronik zum
Werkzeug der Nachrichtenbeschaffung. 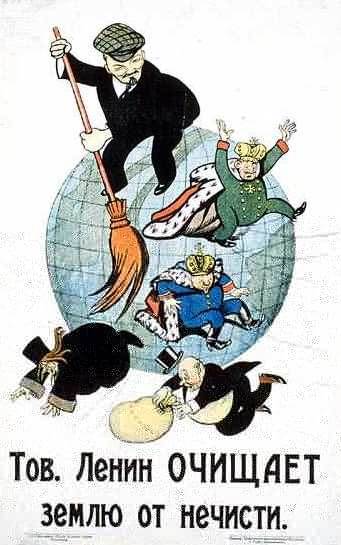 Das "Hamburger Echo" überlebte den Weggang Karl Grobes gerade mal ein Jahr. Der "Vorwärts", zu dem er wechselte, trägt zumindest noch diesen Titel. 1968 kam die historisch bedeutsame Stunde der "Frankfurter Rundschau". Grobes Artikel passten in Zeiten von Notstandsgesetzgebung und Großer Koalition den SPD-Parteioberen nicht mehr ins Konzept. Karl beschloss, den "Vorwärts" zu verlassen und erwog einen Wechsel zum "Weser-Kurier" nach Bremen.
Das "Hamburger Echo" überlebte den Weggang Karl Grobes gerade mal ein Jahr. Der "Vorwärts", zu dem er wechselte, trägt zumindest noch diesen Titel. 1968 kam die historisch bedeutsame Stunde der "Frankfurter Rundschau". Grobes Artikel passten in Zeiten von Notstandsgesetzgebung und Großer Koalition den SPD-Parteioberen nicht mehr ins Konzept. Karl beschloss, den "Vorwärts" zu verlassen und erwog einen Wechsel zum "Weser-Kurier" nach Bremen.